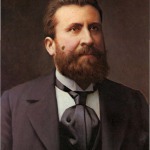Glücklich sterben? Hinweise zum Gespräch im
Religionsphilosophischen Salon am 31.10.2014
Von Christian Modehn
Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf das Problem: Warum muss es tatsächlich schwerstkranken Menschen ohne Aussicht auf eine Form der Genesung und Schmerzfreiheit in Deutschland per Gesetz verboten sein, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um auf selbst bestimmte Art (und ohne sich selbst Gewalt anzutun, wie Sich-Erschießen, Sich-Erhängen usw.) aus dem schwersten Leiden zu treten.
Diesen Schritt des ärztlich assistierten Suizids deuten viele Schwerstkranke selbst als Form der Erlösung. Hans Küng, der katholische Theologe, schreibt in seinem neuen „Glücklich sterben?“ (2014), dass die von ihm angestrebte selbst bestimmte Form des Sterbens mit Hilfe der schweizerischen Organisation EXIT ein Weg zu Gott ist, in der frommen Hoffnung, bei Gott Gnade und Heil zu finden. Für Küng kann es also durchaus dem Willen Gottes entsprechen, wenn ein Christ bei starkem Leiden sich selbst, ärztlich assistiert, definitiv verabschiedet. Für Küng kommt diese Möglichkeit selbst bei „beginnender Demenz“ (S. 23) in Betracht. „Man kann aus Gottvertrauen heraus freiwillig sterben“ (S. 29). „Ich sage immer, das ist für mich die Wahl“ (S. 38).
Dann folgt der Satz, der zu denken gibt: “Es liegt an den Deutschen, die keine Gesetze machen können, damit solch ein Sterbetourismus (in die Schweiz) nicht notwendig ist“ (S. 39). Wobei Deutsche die Hilfen der Organisation EXIT nicht in Anspruch nehmen können; sie ist auf Schweizer Bürger begrenzt, für Nichtschweizer gibt es den –immer wieder umstrittenen- Verein „Dignitas“.
Es sieht allerdings nicht so aus, als würden neue Gesetze für ein selbst bestimmtes Sterben in größter Not der Schmerzen in Deutschland alsbald möglich sein. Da ist die gegenwärtige Regierung viel zu verbissen in der üblichen Abwehr, in der Verbreitung diffuser Ängste (“Dammbruch“), wobei sicher der Blick auf die Macht der Kirchen politisch eine Rolle spielt. Keine Regierung in Deutschland wagt es, mit den Kirchen in einen offenen Streit und Widerspruch zu treten, das gilt auch für Fragen zur tatsächlichen Trennung von Kirchen und Staat oder bei Fragen zur Kirchensteuer und den staatlichen Zuwendungen an die Kirchen gemäß der Gesetze von 1803 usw. Dabei ist allen Beobachtern natürlich klar, wie schwach tatsächlich die Kirchen in Deutschland bereits sind, schaut man nur auf die stetig sinkenden Mitgliederzahlen, auf den stetigen Rückgang in der Teilnahme an den Sonntagsgottesdiensten (außer am Heiligen Abend). Dabei sind die Kirchen in Deutschland finanziell opulent ausgestattete Organisationen mit Milliarden Euro Einnahmen allein durch die Kirchensteuer.
Zum Thema „aktive Sterbehilfe“ wollen wir einige weiter führende, durchaus unbequeme Fragen stellen (nur die ewig gleichen Fragen sind bequem), in dem Bewusstsein, dass dieses Thema niemals leichtfertig besprochen werden darf. Es darf aber auch nicht sein, die seit Jahrzehnten bekannten Vorbehalte und Verbote, auch der Kirchenleitungen, bloß gehorsam nachzubeten und zu wiederholen. Im Gegenteil, es gilt, die legitimen Forderungen der Patienten in ihrer Not endlich zu respektieren und den Forderungen eine rechtliche Form zu geben.
Eine kritische philosophische Prüfung, also in der Distanz von konfessionellen Bindungen, ist nötig. Dabei immer im Blick auf ein ethisches, vernünftiges Leben, um etwas klarer zu sehen und hoffentlich Neues zu erkennen. Dabei müssen wir das weite Umfeld des Themas erst einmal in den Blick nehmen und dabei vielleicht zu überraschenden Erkenntnissen kommen.
Die Kirchen haben seit dem 4. Jahrhundert immer – von ganz wenigen kritischen, oft häretischen Theologen abgesehen – das Töten der Feinde im Krieg für ethisch richtig und geboten gehalten. Sie haben die Waffen gesegnet, mit denen die Soldaten in den Krieg zogen, Christen gegen Christen, in dem festen Wissen, bloßes Kanonenfutter zu sein; die politischen und die mit ihnen verbündeten kirchlichen Herrscher haben also den Tod ihrer armseligen Untertanen, die sich nicht wehren konnten, direkt gern in Kauf genommen, einzig aus nationalistischen, machtpolitischen Gelüsten heraus.
Bis heute sind fundamentalistisch Fromme, Evangelikale und pfingstlerische Kreise die entschiedenen Verteidiger der Todesstrafe, etwa in den USA. Diese Christen haben keine Skrupel, einem anderen Menschen, auch ein Verbrecher ist ein Mensch, den Tod zuzufügen. Diese Menschen, die anderen den Tod zufügen, bedenken nicht die Dialektik, die darin besteht: Wer andere bewusst tötet, der tötet auch seine eigene Seele und seinen Verstand. Insofern ist die Tötung anderer im Krieg oder auf den Elektrischen Stuhl immer auch eine bewusste oder unbewusste Selbsttötung der Tötenden. Das Töten der Seele hat bekanntlich Jesus von Nazareth als viel schlimmer denn das Töten des Leibes betrachtet (Mth 10,28). Insofern ist ein breiter Strom der blutigen Geschichte und der Kirchengeschichte eine lange Geschichte des seelischen Selbstmordes.
Die Märtyrer der frühen Christenheit haben sich oft fröhlich, wie berichtet wird in den Heiligenberichten, in den Arenen Roms und anderswo den Löwen zum Fraß vorgeworfen. So wollten es die heidnischen Kaiser, weil sich diese Christen weigerten, bestimmte einfache Formen der heidnischen Herrscherkulte mit zu vollziehen. Diese dann offiziell hoch gepriesenen christlichen Helden und Heilige kann man durchaus als „begeisterte Selbstmörder“ verstehen, um den Titel eines Buches von Dries van Collie (1960, bezogen auf die Christenverfolgung in China unter Mao) aufzugreifen.
Dieses Verhalten der heiligen, begeisterten Selbstmörder der frühen Kirche hat nie ein Herr der Kirche auch nur ansatzweise kritisiert. Diese Heiligen gelten als gute Selbstmörder, weil sie einer guten Sache dienten, nämlich der Standfestigkeit der christlichen Kirche.
Schlechte Selbstmörder sind jene, die in größter Qual um ärztliche Hilfe zum Tod bitten. Dabei vertreten sie doch eine gute Sache, nämlich den grenzenlosen Respekt vor der subjektiven Freiheit, die ja bekanntlich die klassische Tradition als „der Güter Höchstes“ bewertet.
Wir nehmen uns selbstverständlich die Freiheit, auch zu fragen, ob die Entschiedenheit Jesu von Nazareth, seinen Weg der Gerechtigkeit und Treue seinem eigenen Gottesbild gegenüber nicht auch eine Dimension des Suizids hat: Wir wissen, diese Frage ist ketzerisch und wurde so selten öffentlich gestellt. Tatsache ist: Jesus von Nazareth weiß im Laufe seines Prozesses genau, dass er sich freiwillig dem Tod überliefert, wenn er bei Gericht nicht widerruft. Und er hat nicht widerrufen, ist also freiwillig in den – vorzeitigen, also nicht natürlichen, äußerst schmerzlichen Tod gegangen. Diese Deutung des Todes Jesu überrascht viele orthodox fixierte Christen, die sich nur der Deutung Jesu durch die späteren Theologen anschließen: Jesus habe sozusagen sterben müssen, um Gott mit der Welt zu versöhnen. Dies ist eine theologische Behauptung aus einem alten Weltbild, das heute der kritischen Betrachtung nicht standhält. Jesus von Nazareth ist freiwillig in den Tod gegangen, er hat am Kreuz geschrieen: Mein Gott, warum hast du mich verlassen. Das ist die Basis, auf der man ernsthaft theologisch diskutieren kann. Alle anderen Bilder und Dogmen, die sich durchgesetzt haben, wie Sühnetod, Versöhnung mit dem zornigen Gott usw. haben für aufgeklärte religiöse Menschen eine sehr geringe Relevanz.
Viele andere Menschen, die den eigenen Tod gezielt anstrebten und annahmen, etwa Widerstandskämpfer, haben sich auch bewusst dem eigenen Tod ausgesetzt. Gilt ihr Tun als Wahl des eigenen Todes deswegen nicht als verachtenswerter Suizid, weil ihr Handeln einem „guten Zweck“ diente? Gibt es also gute und selbst von Christen verteidigte gute Suizide und eben schlechte Suizide derer, die nichts anderes anzielen, als endlich keine unerträglichen Schmerzen mehr zu haben. Diese Menschen möchten in ihrem Leiden nichts anderes als sich auch friedlich verabschieden, mit ärztlicher Hilfe wollen sie gern möglichst schmerzfrei sterben, so wollen sie einen Beitrag leisten für eine neue Kultur des Sterbens (!) Noch einmal: Diesen ärztlich assistierten Suizid ziehen sie der üblichen Zwangspraxis vor, vom Staat diktiert, die sie nötigt, sich irgendwo im Wald eine Pistole in den Mund zu stecken und sich abzuknallen wie einen Verbrecher.
Entscheidend ist: Wir sollten die Diskussion über Suizidbeihilfe und über aktive Sterbehilfe in den großen Rahmen stellen der europäischen Emanzipationsgeschichte: Dies ist die Geschichte des Kampfes um Freiheit, um individuelle Freiheit wie Freiheit in Staat und Gesellschaft. Nur einige wenige Beispiele: An dem Kampf um die Rechte der Frauen wäre zu erinnern, an den Kampf um das Frauenwahlrecht oder die schlichte Tatsache, dass Frauen auch ohne Zustimmung des Gatten ein Bankkonto eröffnen können; an den Kampf um den Respekt für Homosexuelle bis hin zu Homoehe und Homo-Elternpaaren mit ihren Kindern wäre zu erinnern; an den Kampf um die „Pille“ oder an den Kampf um die legitimen Forderungen nach Abtreibung in bestimmten gesetzlichen Grenzen usw.
In allen diesen erfolgreichen Kämpfen wurde die individuelle Freiheit durchgesetzt, die Machthaber mit ihrer eigenen rigiden Moral der Unterdrückung der subjektiven Freiheiten wurden sozusagen entthront.
Das heißt aber nicht, dass mit jeder neuen gesetzlichen Regelung im Rahmen der Reformen auch immer rundherum alles Bestens läuft. Eine Gesetzesreform, die rundherum total nur Gutes bringt, gibt es nicht. Dies auch von den bevorstehenden neuen Gesetzen zur Suizidbeihilfe und zur aktiven Sterbehilfe zu verlangen, wäre naiv. Aber die oben genannten Beispiele der Emanzipation zeigen, dass doch die Befreiung gegenüber dem alten Zustand der Unterdrückung und Verfolgung (etwa der Schwulen) ungleich besser und wertvoller ist.
Warum also sind die Kirchenführer und die meisten ihnen gehorchenden Theologen gegen die gesetzliche Neuregelung von Suizidbeihilfe und aktiver Sterbehilfe? Wir vermuten: Weil sie mit dieser Reform tatsächlich ihre aller letzte noch verbliebene Bastion verlieren könnten, von der aus sie die Gewissen lenken und leiten können … und auch die Gesetze. Mit anderen Worten: Der Kampf gegen die neue gesetzliche ärztlich assistierte Suizidbeihilfe ist auch der Kampf der Kirchen um die letzte noch verbliebene gesellschaftliche Macht.
Wir fördern und fordern mehr Hospize, keine Frage, sie sind hilfreich und sinnvoll, auch wenn sie nur eine Minderheit erreichen. Im vergangenen Jahr starben in stationären Hospizen Deutschlands 9.000 Menschen. In ambulanten Hospizen, also in den Wohnungen der Sterbenden, starben 37.000 Menschen. Aber Palliativstationen und Hospize sind aber nicht die absolut beste und einzige Antwort. Selbst katholische Ärzte in Palliativstationen und Hospizen bestätigen das, etwa die katholische Ärztin Corinne van Oost aus Belgien in der neuen Ausgabe der Zeitschrift „Le Monde des Religions“ (Paris, November 2014, Seite 22 f.) Sie betont in dem Interview, aus Mitleid zu handeln, wenn sie Schwerstkranken hilft, durch die in Belgien gesetzlich mögliche Euthanasie sterben zu können. „Es ist die Gewissheit mit meiner ganzen ärztlichen Equipe, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt“. Die übliche Lösung, den Kranken mit hohen Opium Dosen total in den Schlaf zu schicken, hält sie für keine gute Lösung. „Denn da ist der Kranke total von seiner Umgebung abgeschnitten. Die gibt es dann keine Begleitung mehr“.
Philosophisch entscheidend ist ein weiterer Hinweis: Ich muss nicht leben. Es gibt keinen Zwang, dass ich leben muss. Ich darf leben, will leben, kann leben, aber niemals gilt: Ich muss leben: Bestenfalls im Blick auf andere, die mich unbedingt brauchen, für die ich leben will bloß aus Mitleid mit ihnen. Aber das ist die Ausnahme.Nur Diktatoren reden mir ein, ich müsste unter allen Umständen leben. Fidel Castro z.B. war empört, als sich ein Companero selbst tötete. Totalitäre Staaten wollen Menschen zwingen zu leben zwingen, sie wollen sie sozusagen binden an den Aufbau des eigenen Staates usw.
Der zentrale Punkt ist: Das „Geschenk des Lebens“ kann ich auch wieder zurückgeben.
Es ist ja ein klassischer Topos: Das menschliche Leben ist für mich Geschenk, also darf ich es selbst nicht abgeben, zurückgeben. Tatsache aber ist: Das Geschenk wird nicht vom Schenkenden bleibend und ständig bestimmt. Ich bin als der Beschenkte nicht verpflichtet, ein Geschenk ständig zu bewahren. Das gilt, wenn ich Gott personal verstehe oder eher offen an eine schöpferische Urkraft denke.
Gott als der Schenkende „will“, dass wir in aller Freiheit uns selbst mit diesem Geschenk persönlich auseinandersetzen und inmitten unseres Lebens entwickeln. Es gibt den Spruch: Achte auf den Zusammenhang von Gabe und Aufgabe. Es gibt immer den Aufruf zum eigenen, individuellen Handeln mit dem mir gegebenen Leben. Gott spricht nicht unmittelbar in mein Leben hinein, und er sagt mir nicht, wie ich mit seinem Geschenk, also meinem Leben, umgehen soll. Nach Gesetzen der Ethik und der Vernunft, gewiss, aber Gott überlässt mir vollkommen den Umgang mit seinem Geschenk. Und das lässt auch die Möglichkeit offen, dass ich im Fall von äußersten Leiden dieses Geschenk zurückgebe.
Wir zitieren gern eine Einsicht des Renaissance Philosophen Pico della Mirandola (1463 bis 1494): Er lässt Gott zum Menschen sagen
„Du sollst deine Natur ohne Beschränkung, nach deinem freien Ermessen, dem ich dich überlassen habe, selbst bestimmen“ (zit. aus „Enzyklopädie Philosophie“, Band III, S. 2411, in einem Beitrag von Volker Gerhardt).
Wichtig erscheint uns das Buch von Christiane Berkvens-Stvelinck, „Vrije Rituelen“ (2012), in der die Remonstranten Theologin (Rotterdam) zusammen mit Pastor Johan Blauuw einen eigenen Ritus im Falle von Euthanasie beschreibt und zur Nachahmung empfiehlt. Bekanntlich ist ja in Holland seit 2002 Euthanasie gesetzlich möglich, dieses Wort verwenden Holländer, in Deutschland gibt es gegenüber dem Begriff verständlicherweise Vorbehalte).
Angeraten wird der um das Sterbebett versammelten Familie/dem Freundeskreis, etwa eine Kerze anzuzünden, ein Gedicht, ein Gebet, einen Psalm vorzutragen, Erinnerungen auszutauschen, ein buntes Band zu legen, das alle, auch den Sterbenden, verbindet zu einer großen Gemeinschaft. Und dann wird ein Gebet empfohlen, das wir hier in der Übersetzung anbieten:
Ewiger.
Jetzt nähert sich der Moment des Abschiednehmens
Weil das Leben seinen Glanz verloren hat
Und der Körper kein Zuhause mehr ist
Um darin noch zu wohnen.
Deswegen geben wir dir, dem Ewigen, das Leben zurück.
Als ein Geschenk hast du uns das Leben gegeben.
Jetzt, wo dieses Geschenk nicht länger erfreut
Weil die menschlichen Möglichkeiten, um dieses Geschenk zu genießen
Viel zu begrenzt wurden.
Deswegen geben wir dir in Dankbarkeit, dem Ewigen,
dieses Geschenk zurück.
Mögest du es annehmen und aufnehmen
In deiner Barmherzigkeit und in deiner Liebe.
Segne dieses Leben
Mit dem Licht deiner Augen und mit dem Frieden,
der allen Verstand noch einmal überragt. Amen.
Aus: Christiane Berkvens-Stevelinck, Vrije Rituelen“. Untertitel: „Vorm geven aan hat leven“.
Verlag Meinema,in Zoetermeer. 2007. ISBN 978 90 211 4152. Das Gebet befindet sich auf Seite 98. Übersetzt von Christian Modehn
Es kommt in den gegenwärtigen und zukünftigen Diskussionen darauf an, von der bloßen Fixierung auf neue Gesetzestexte wegzukommen zugunsten der umfassenderen Frage: Was ist eigentlich gutes Sterben? Sterben ist kein technisches und auch kein bloß medizinisches Problem. Diese Frage sollte im Mittelpunkt stehen: Wie kann eine Kultur des Sterbens entstehen, in einem Miteinander, das wieder gepflegt werden sollte angesichts des Zusammenbruchs der alten Großfamilien. Wie können würdige Abschiedsfeiern gestaltet werden? Das gelingt nur, wenn sich tatsächlich die zum Sterben entschlossenen Menschen/Patienten bei Bewusstsein und schmerzfrei verabschieden können.
Die Kirchenführer sind fixiert auf den Erhalt der bisherigen Gesetze. Sie haben wie immer Angst vor Neuerungen und Reformen. Sie haben das Wort Zuversicht aus ihrem Vokabular gestrichen, Ist das christlich? Sie sehen auch jetzt wieder die üblichen Dammbrüche und Katastrophen, sind aber nicht in der Lage, einmal nach Holland zu schauen, nach Belgien, in die Schweiz usw., um zu fragen: Ist dort tatsächlich Mord und Totschlag an der Tagesordnung, bedingt durch liberalere Gesetze beim Sterben. Die alles Wissenden deutschen Theologen und Pfarrer, ebenso die mit den Kirchen verbandelten Politiker, sprechen nicht mit Pfarrern und Theologen aus der schweizerischen, belgischen und holländischen Nachbarschaft, die selbstverständlich Menschen in den letzten Stunden begleiten, wenn sie unter ärztlicher Assistenz aus dem Leben scheiden und von schwersten Schmerzen befreit, erlöst, werden.
Die Kirchen in Deutschland könnten ihre eigentliche Aufgabe wahrnehmen, wenn sie den Prozess der Freiheit und Befreiung auch in Fragen des Sterbens zunächst einmal bejahen und aus dieser Bejahung dann auch mitgestalten. Sie sollten sich fragen, wenn sie schon auf die Bibel starren, wo denn in der Bibel der Suizid verboten ist.
Durch das pure Pochen, langweilig, ängstlich und autoritär wie eh und je, begeben sich die Kirchen wieder mal selbst ins Getto.
Religiöse Menschen und religionsphilosophisch Interessierte sollten hingegen den Prozess der Befreiung auch im selbst bestimmten Sterben mitgestalten, statt ihn permanent zu bejammern. Eine starre Haltung hat, wie immer in der Geschichte, keine Zukunft.
Diese Erstarrung aus Angst vor neuen Gesetzen diskreditiert alle Versuche, eine neue Ordnung zu schaffen, in der auch die jetzt qualvoll Leidenden und zum Tode Entschlossenen eine humane Antwort finden. Dann könnte endlich auch einmal nicht nur vom Sterben, sondern von dem viel anspruchsvolleren Thema „TOD – Was ist das?“ gesprochen werden. Die langen Debatten rund um das Sterben haben das Thema Tod und definitive Endlichkeit in den Hintergrund treten lassen. Leider, meinen wir.
Ein Hinweis zum Schluss:
In der katholischen Monatszeitschrift HERDER Korrespondenz Heft 11 (2014 Seite 567 ff.) wird ein Beitrag von Giovanni Maio publiziert, er ist als Arzt in München Uni-Professor für Medizinethik,, (philosophisch M.A.) und Mitglied des Ausschusses für ethische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer UND Berater der Deutschen (katholischen) Bischofskonferenz, eine interessante Verbindung und Nähe übrigens.
Sein Beitrag hat den Titel: „Handhabbarer Tod? Warum der assistierte Suizid nicht die richtige Antwort ist“.
Wir können aus diesem viele alte bekannte Argumente wiederholenden Beitrag nur darauf hinweisen, wie da gegen die Menschen argumentiert wird, die in größter Not der Schmerzen aus diesem Leiden befreit werden wollen. Kein einziger Patient, der um assistierten Suizid bittet, wird zitiert, kein Verteidiger dieser Position auch nur namentlich erwähnt. Ein merkwürdiger arroganter Beitrag, meinen wir.
Herr Maio unterstellt, diese um den assistierten Suizid bittenden Menschen würden sich in ihrem Leben jetzt „überflüssig“ fühlen (s. 568), sie würden sich „wertlos vorkommen“, „als Last, als Bürde, ja als Zumutung für andere“ (ebd.). Dass die Überwindung unerträglichen Leidens aus freier subjektiver Kraft die erste Rolle spielt, wird in dem Beitrag nicht gesehen. Das Gefühl lästig zu sein, kann ihnen auch von Geld gierigen Gesunden eingeredet werden. Und das passierte immer schon, auch vor der debatte um die assistierte Sterbehilfe.
Hingegen wird zurecht gesagt, es sei alles Erträgliche zu tun, „um Suizidwünsche zu vermeiden“ (ebd). Das ist ja richtig im Fall eines allgemeinen Suizidwunsches, aus Liebeskummer, mieser Stimmung usw., das gilt aber nicht für den Sonderfall des assistierten Suizides im Falle schwerster und aussichtsloser Krankheit.
Autonomie versteht Herr Maio falsch, indem er Autonomie deutet ,„alles ohne Hilfe Dritter machen zu können“ (S. 569). Autonomie aber kann niemals ohne die Bezogenheit auf andere verstanden werden. Entscheidend ist: Es muss jedoch eine freie und gleichwertige Beziehung sein, keine Beziehung der Herrschaft und des Oben und Unten. Herr Maio verwechselt offenbar Autarkie und Autonomie.
Dann meint er den assistierten Suizid deswegen abweisen zu können, weil dieser ein Mittel sein soll der Leidverhinderung und sogar Leidenslinderung (s. 569). Es geht nicht um die Verhinderung von Leiden im Fall des assistierten Suizides, sondern um die definitive Abweisung eines Lebens, das nichts mehr als Leiden ist. Es geht um Befreiung und Erlösung aus diesem Leib und der Hinkehr zu Gott, so fromme Menschen, wie Hans Küng.
Es geht auch nicht um die Schaffung „einer leidlosen Gesellschaft“, wie Herr Maio suggeriert, sondern nur um die Abwehr des einzelnen, definitiv schmerzhafteste Zustände zu ertragen. Natürlich wird auch ein Schwerstkranker noch das Leiden von Zahnschmerzen etc. ertragen. Indem, wie so oft üblich in konservativen Kreisen, der assistierte Suizid so in maßlose, globale und gerade alberne Dimensionen wie „Forderung nach Leidlosigkeit“ gezogen wird, werden Schreckgespenster wachgerufen. Die Utopie, dass sich in „besserer Zukunft“ (S. 570) „alle sich um den alten Menschen ranken, ihn verehren“ (ebd.) soll bitte den Politikern der CDU und SPD nahe gebracht werden, sollen sich diese Herrschaften einmal dem Gespräch stellen mit den Betroffenen. Und dann sollen sie bitte noch ca. 10.000 weitere stationäre Hospize in Deutschland bauen und dabei zur Finanzierung auf ihr üppiges Salär verzichten zugunsten der alten Menschen, „um die sich alle ranken” (? ) und „die alle verehren“.
copyright: Christian Modehn Religionsphilosophischer Salon Berlin