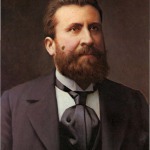Die „Weihnachts-Spiritualität“ wird immer beliebter: Das Weihnachtsoratorium als Gottesdienst.
Ein Hinweis
Von Christian Modehn
„Der Tagesspiegel“ berichtet am 14. Dezember 2014 unter dem Titel „Herzen in die Höhe“ über die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums von J.S.Bach in Berlin zur Advents- und Weihnachtszeit. Der Artikel von Carsten Niemann nennt eine interessante Statistik: „Mit rund 50 Aufführungen pro Saison hat wohl keine andere Stadt der Welt eine solch hohe Dichte der Darbietungen der 1734 entstandenen sechs Kantaten aufzuweisen“ (S. 27). Und das Interesse des Publikums am Weihnachtsoratorium von Bach und die Bereitschaft der Sängerinnen und Sänger sowie der Orchestermitglieder (oft ebenfalls hoch qualifizierte „Laien“), das Werk immer wieder neu aufzuführen, sei ungebrochen groß. Wie viele Menschen hören in einem Jahr das Weihnachtsoratorium in der “gottlosen” Stadt Berlin? Einige tausend sind es gewiss.
Wer sich für Spiritualität in der Stadt und damit auch für die Relevanz der Kirchen und Gottesdienste in der Stadt Berlin interessiert, sollte sich auch soziologisch und religionswissenschaftlich mit der Beliebtheit des Weihnachtsoratoriums gründlich auseinandersetzen (und dann eben auch mit den sicher genauso beliebten Matthäus-Passion und Johannes Passion). Das Weihnachtsoratorium bestimmt das Bild von Weihnachten bei vielen tausend Menschen. Man bräuchte eine Statistik, die die Teilnehmerzahl an den Aufführungen deutlich macht, die Anzahl der Chormitglieder erforscht, deren Motive, alle Jahre wieder das Weihnachtsoratorium zu singen. Es wäre nach dem spirituellen Hintergrund der Hörer wie der Aufführenden zu fragen. Diese Informationen liegen nicht vor. Eine “Theologie für Berlin und über Berlin” hätte hier ein gutes Thema. Das bearbeitet bloß unseres Wissens niemand. Darum können nur Vermutungen und Fragen geäußert werden:
1.
Weihnachten ist und bleibt für viele Menschen immer noch ein „Grund“, eine christliche Kirche zu betreten und sei es wegen des Weihnachtsoratoriums. Musik berührt mehr die Herzen als das langatmige Wort?
2.
Auch wenn die Aufführungen in einem Konzertsaal geboten werden, haben sie doch keine säkulare, bloß ästhetisch interessante Bedeutung. Diese Aufführungen in weltlichen Räumen haben auch eine spirituelle Dimension. Sind die Gottesdienste in säkularen Räumen nicht auch Gottesdienste? Gewiss, wie die Weihnachtsoratorien, die in den Kirchen aufgeführt werden.
Wir meinen, Weihnachtsoratorien sind immer Gottesdienste, also meditative Stunden, wenn auch die sprachliche Gestalt des Oratoriums für viele befremdlich ist. Deswegen wird auch sozusagen der schönen Musik und der Gesamtstimmung wegen der Text oft „überhört“ (also ignoriert ?).
In jedem Fall sind es wohl viele tausend Berliner und ihre Gäste, die dem Weihnachtsoratorium still für sich hörend folgen, dabei in einer hörenden Gemeinschaft verweilend, und dabei auch bestimmte spirituelle Eindrücke „mit nach Hause“ nehmen. Dieser „Effekt“ entspricht genau der Wirkung einer guten Predigt. Nur kann man darüber leichter ins Gespräch kommen als etwa über das Lied „Vom Himmel hoch da, komm ich her, ich bring euch gute, neue Mär…“
3.
Wenn für viele Menschen im Laufe eines Jahres ganz zentral Weihnachten der spirituelle, auch musikalisch spirituelle Höhepunkt ist und vielleicht überhaupt das einzige spirituelle Ereignis im Jahr, dann könnte gefragt werden: Wird in dieser Präferenz von Weihnachten tatsächlich das Zentrum des christlichen Glaubens getroffen? Anders gefragt: Hat jemand das Christentum verstanden, wenn er beinahe nur Weihnachten kennt. Sicher nicht. Denn schon für die ersten Christen war die Geburt Jesu ein Randthema. Der erste christliche Schriftsteller, der Apostel Paulus, erwähnt Weihnachten gar nicht. Die Predigt Jesu, seine Bergpredigt, insgesamt das Leben Jesu, das zur Hinrichtung führt und zu einer Form der bleibenden Bedeutung (Auferstehung), ist wichtiger als Weihnachten.
In unserer Sicht gibt es eine Bedingung, für ein adäquates Verstehen von Weihnachten, die der Berliner Theologe Prof. Wilhelm Gräb in verschiedenen Interviews für diese Website nennt: Die Menschen können zu Weihnachten erleben und begreifen, dass mit der Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth (das ist Weihnachten) die Gottesverbundenheit EINES JEDEN Menschen greifbar wird, offen gelegt werden soll. Weihnachten ist also als das Fest der innigen Gottesnähe in JEDEM Menschen ohne jeglichen Ausschluss. Jeder Mensch ist absolut wichtig. Jeder Mensch hat Anspruch auf elementare Rechte (und Pflichten). Das ist eine radikale Aussage mit entsprechenden ethischen und politischen Konsequenzen.
Von da aus wäre dann weiter über die „Sakralität der Person“ (Hans Joas) zu sprechen und den Menschenrechten usw. Weihnachten wird so zur spirituellen Ermöglichung, dass Menschen eine gerechtere Welt für alle mitgestalten… Weihnachten wäre ein Fest der Menschenrechte.
Aber kann das Weihnachtsoratorium vor dem Kitsch und dem Konsum des Weihnachtsrummels bewahren, bietet es Widerstandskräfte dagegen? Wir wagen es zu bezweifeln. Den blinden Kaufrausch in der reichen Welt hat kein Weihnachtsoratorium – bis jetzt – gestoppt
4.
Darum – so unser Vorschlag – sollte mit der gleichen Intensität, mit der immer wieder das Weihnachtsoratorium aufgeführt wird, auch neue, zeitgemäße spirituelle Chormusik, auf höchstem Niveau, gerade zu Weihnachten aufgeführt werden. Vielleicht als 2. Teil zu Bach, als Kontrast, als musikalisches Fragezeichen für die Hörer. Sicher aber auch als eigene Veranstaltung. Der Eindruck herrscht doch vor: Weihnachten sind nette Geschichtchen, nette musikalische Erbauung, viele Kindheitserinnungen usw., alles unterstützt durch Weihnachtslieder, deren Inhalt sich niemandem mehr spontan erschließt, man singt Liedchen und weiß nicht, was sie bedeuten. Hat die inflationäre Aufführung des Weihnachtsoratoriums daran Anteil?
Wer etwas anderes wünscht, dem können wir nur dringend die Lieder des Dichters und Theologen Huub Oosterhuis (Amsterdam) empfehlen. Sie sind musikalisch von hohem Niveau und vom Text her alles andere als fromme oder gar banale Sprüche, denen man sonst in so vielen modernen Kirchensongs begegnet. Mit anderen Worten: Etwas weniger Bach, etwas weniger Weihnachtsoratorium, wäre für die Entwicklung einer spirituellen und auch theologischen Vertiefung sicher förderlich. Wer geht denn in die Oper, um immer nur „Die Entführung“ zu hören?
Copyright: Christian Modehn, Religionsphilosophischer Salon Berlin.